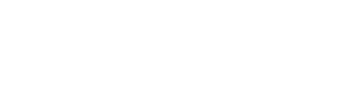Mani - karge Schönheit im Süden der Peloponnes
Sandsteinfarben und backsteinrot - die Farbtöne uralter byzantinischer Kirchen, silbriges Ölbaumgrün in den Olivenhainen, das Türkis des Meeres und das Weiß der Felsenhänge des Taygetos-Gebirges finden sich auf der Farbpalette dieser besonderen Gegend.
„Vielleicht“, sagt Georgios Koufopoulos, „habe ich noch fünf Kirchen vor mir.“ Der große Mann, ein Bild von einem Griechen, spricht ruhig und leise. Etwas Wehmut liegt in seinen Worten. In zügiger Fahrt kutschiert er seinen etwas ramponierten Pickup über die engen Gebirgsstraßen der Mani. Georgios will uns das Resultat seiner Arbeit zeigen: restaurierte byzantinische Kirchen. Die Wiederherstellung der jahrhundertealten Monumente ist sein Leben und seine Mission. Georgios ist Mitte 50, in seinen schwarzen Vollbart mischen sich silbrige Fäden. Länger als zehn weitere Jahre, so meint er, könne er seinen körperlich fordernden Beruf nicht mehr ausüben. „Seine“ Kirchen sind also gezählt.
2001 hat Georgios zusammen mit seinem Bruder das Unternehmen „Mnimeiotechniki“ gegründet, das die komplexen, zumeist von privaten Gönner*innen finanzierten Rettungen organisiert. Georgios koordiniert die Projekte und ersinnt Spezialkonstruktionen, um Gebäudefragmente zu stabilisieren. Abhängig vom Umfang der Arbeiten kann es vorkommen, dass Architekt*innen, Konservator*innen, Klimatechniker*innen, Steinmetz*innen und noch viele weitere Professionen jahrelang mit einem Bauwerk beschäftigt sind.
Die Mani gibt einen fruchtbaren Boden für diese Art von Projekten ab. Über 1.000 Kirchen soll es auf dem bloß 70 Kilometer langen südlichen Ausläufer der Peloponnes geben. Eine große Anzahl davon sind mittelbyzantinische Kreuzkuppelkirchen, entstanden im Zuge einer großangelegten Mission im 10. Jahrhundert. Sie sollte die Bewohner*innen der abgelegenen und unwirtlichen Gegend für das Christentum gewinnen. Die Kirchen sind aus Tuffstein errichtet, ein bis ins 20. Jahrhundert hinein beliebtes Baumaterial. Leicht und bruchfrisch einfach zu bearbeiten, härtet der Stein im Lauf der Zeit aus und trotzt dann beständig der Witterung. Er verleiht den Kirchen ein Äußeres aus Spielarten von hellem Gelb, Braun oder Grau, das sich organisch in seine Umgebung einfügt. All diese Farbtöne strahlen Ruhe aus und entfalten eine entspannende und einladende Wirkung – was könnte geistlichen Bauwerken besser zu Gesicht stehen?
Ein Land der An- und Aussichten
An Gestein herrscht auf der Mani generell kein Mangel, schließlich bildet das Taygetos-Gebirge ihr Rückgrat. Das Weiß seiner felsigen Hänge schwingt sich in dramatischer Manier himmelwärts, der beinahe perfekte Kegelgipfel des Profitis Elias erreicht eine Höhe von über 2.400 Metern. Dort hält sich in manchen Jahren bis ins Frühjahr hinein der Schnee. Es scheint, als würde ein unsichtbarer, aber umso eifrigerer Kulissenschieber immer neue Ansichten hervorzaubern, um Besucher*innen der Mani mit ständig wechselnden Ausblicken zu beglücken. Der legendäre englische Reiseschriftsteller Patrick Leigh Fermor (1915 bis 2011) beschreibt die Eindrücke eines Fußmarsches im Taygetos folgendermaßen:
„Ein letzter Schritt, und wir waren auf der anderen Seite, auf der Mani. Eine Wildnis aus kahlen grauen Felszacken ragte drohend aus dem Gewirr der Felsspalten zu Höhen wie der unserern auf, wenn sie sie nicht gar noch übertrafen; in irrwitzeigen Winkeln ging es in die Tiefe, und es war unmöglich zu sagen, was eine ganze Welt tiefer, am Boden schon des nächsten Canyons lag. Außer an den Stellen, wo die scharfen Kanten durch Geröll gemildert waren, wirkten die Felsen hart wie Stahl, war eine unbelebte Landschaft, wie auf einem fernen Planeten, eine Landschaft, in der Drachen hausen mochten. Nichts regte sich.“
Doch damit ist das Bild nicht vollständig: Die Täler des Taygetos sind fruchtbar, die schmale Ebene an seinen westlichen Abhängen ist geprägt vom silbrigen Grün ausgedehnter Ölbaum-Haine. Das aus der Ernte gewonnene Öl ist hochwertig, viele Manufakturen setzen auf biologische Landwirtschaft und nachhaltige Produktionsmethoden, über die sich Besucher*innen in den Betrieben informieren können.
Finden sich Quellen oder kommt gar ein Bach die Schluchten herab, wird die Mani grün, wuchern mannshohe Farne, Brombeerhecken und wilde Kräuter. Sogar ausgedehnte Wälder gibt es, in denen Kastanien, Eichen oder Feigenbäume gedeihen. Zunehmend schmäler zulaufend und gegen Süden immer schroffer werdend, schiebt sich die Mani weit ins Mittelmeer hinaus, ehe am Kap Matapan mit seinem Leuchtturm ein romantisches „Finis Terrae“, ein „Ende der Welt“, erreicht wird. Es scheidet das ionische vom ägäischen Meer und ist zugleich der südlichste Punkt des griechischen Festlandes – es liegt auf demselben Breitengrad wie die Straße von Gibraltar.
Vom Parkplatz nahe einem Wirtshaus, dem einzigen Gebäude im gesamten Sichtkreis, führt ein Pfad zum Leuchtfeuer hinaus. Ein lohnender Ausflug über den Rücken des letzten Ausläufers der Mani – violette Blütenteppiche auf den ansonsten öden Geröllhängen erfreuen das Auge. Doch Vorsicht: Auf dem zwei Kilometer langen Weg spendet allein eine einsame Tamariske nahe dem Meer Schatten in der Sommerhitze. Das kühle Wasser der kleinen Bucht ist transparent und gleichzeitig von einem so perfekten Türkis, dass jedes karibisches Gegenüber vor Neid erblassen muss. Anstatt bloß zu schwimmen, scheinen Boote schwerelos über der Tiefe zu schweben.
Georgios ist nun richtig in Fahrt – von einer Kirche geht es zur nächsten. Wir kommen in den Genuss einer Rundfahrt durch die Umgebung unseres Wohnortes Agios Dimitrios, einem kleinen verschlafenen Weiler am Meer, wo wir ihn durch das Glück des Zufalls kennengelernt haben. Will man auf der Mani etwas herumkommen, ist ein eigenes Fahrzeug unverzichtbar. Öffentlicher Busverkehr existiert nur auf der magistralen Nord-Süd-Verbindung von und nach Kalamata, die sich als passabel ausgebaute Überlandstraße erweist. Die Mani ist ein Land der Dörfer, die sich trutzig an die Hänge krallen – das gilt auch dann, wenn sie sich, wie der auf einer Hochebene gelegene Hauptort Areopoli, Stadt nennen. Keiner der pittoresken Ansiedlungen gleicht der anderen, doch in den meisten finden sich befestigte Wohn- und Wehrtürme, die wohl eigentümlichsten Gebäude der Mani. Selten fehlen Denkmäler von Helden aus kriegerischer Vergangenheit: Das Haupt von einer turbanartigen Kopfbedeckung umhüllt, blicken beschnurrbarte Patriarchen bis an die Zähne bewaffnet streng in die Welt.
Beim heiligen Feldherrn
Nach rumpeliger Strecke über einen staubigen Feldweg führt uns ein kurzer Fußmarsch zu „Ai Stratigos“. Dem Erzengel Michael geweiht, bedeutet der Name der Kirche übersetzt in etwa „Heiliger Feldherr“. Sie steht einsam in einem ausgedehnten Olivenhain, dunkle Eichen wachen feierlich im Hintergrund. Allein der Gesang der Zikaden erfüllt die Stille der flirrenden Mittagshitze. Georgios‘ Augen leuchten, als er uns die ungewöhnliche Gliederung des Portikus nahezubringen versucht, die Herrenhäuser der byzantinischen Aristokratie zu imitieren scheint. Sein Mauerwerk ist in der Cloisonné-Technik gestaltet, bei der dünne rote Ziegel oder gemusterte Bänder die einzelnen Steine an allen Seiten voneinander trennen. Das Backsteinrot dieser einfachen und gerade dadurch umso eindrucksvolleren Ornamentik findet sich auch in den Dachziegeln der Kirche und bildet einen wunderbaren Kontrapunkt zum Beige des porösen Tuffs.
Wir kehren zur Stärkung in Thalames ein, einem traditionsreichen Ort hoch über dem Meer, einst berühmt für seine heiligen Quellen und ein Orakel. Auf dem von großen Platanen beschatteten zentralen Platz stehen ein 1714 erbauter Brunnen samt antiker Säule und – in einem Steinhaus aus dem Jahr 1918 – die wunderbare Taverne „O Platanos“. Fisch findet sich hier oben nicht auf der Speisekarte, dafür aber Herrlichkeiten wie Omelette mit Wildspargel, Mandarinenkuchen oder die ebenso absonderliche wie schmackhafte Kombination aus gegrilltem Käse und Birnenmarmelade.
Es ist bereits tiefer Nachmittag, als wir uns von Georgios verabschieden und einen steilen Saumpfad in Angriff nehmen. Sich durch die Phrygana schlängelnd, einer von niedrigem, immergrünem Busch- und Strauchwerk geprägten Vegetation, führt er über Stock und Stein an die Küste hinunter. Das Gemecker von Ziegen und sanftes Glockengeläut liegen in der Luft. Weit können sie nicht sein, doch zu Gesicht bekommt man die Tiere nie. So gelangen wir des Abends zurück nach Agios Dimitrios. Dort geht alles seinen gewohnten Gang. Die Fischer halten im winzigen Hafen Nachschau bei ihren Booten, die Katzenkolonie im Nachbarhaus beginnt sich nach einem verdösten Hitzetag zu räkeln. Ihr bester Freund, der dicke Hund, gähnt ausgiebig. Wieder ist jetzt alles anders, das Wasser tintenschwarz und mondbeglänzt. Am Ende eines Tages voller Eindrücke kann man nun, rücklings im lauen Nass dümpelnd, in das sternenvolle nächtliche Firmament schauen.
Autor: Michael Robausch
Folge lebensart-reisen auf instagram>>>
zuletzt geändert am 12.11.2024